Hustle Culture: Erst der Kick, dann der Knockout
Wer im Job eine Hustle Culture feiert, ist immer „on“. Möglichst viel leisten, egal, wie stressig - warum Menschen Grenzen überschreiten und was daran problematisch ist.
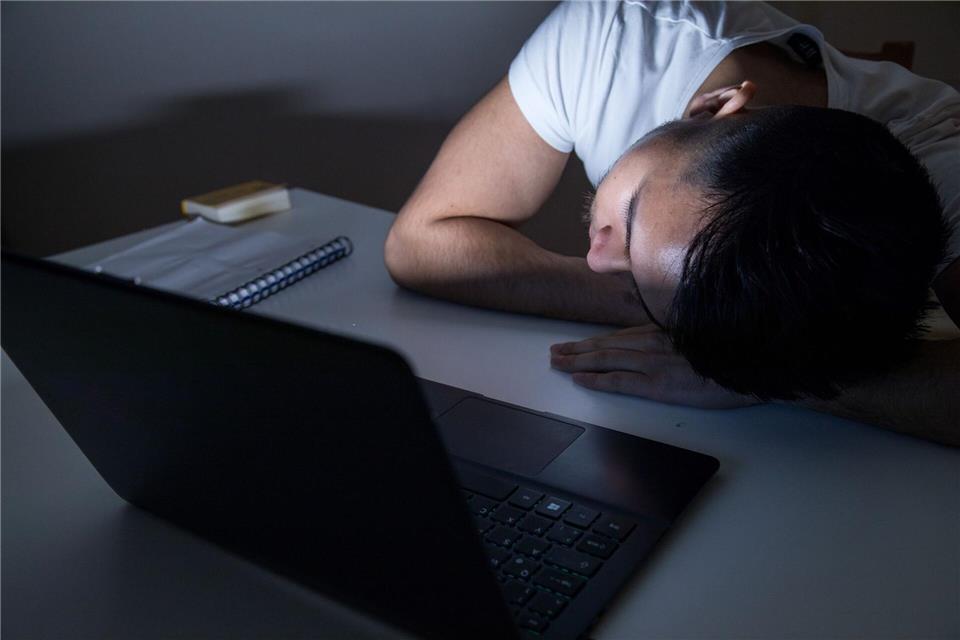
Hustle Culture beschreibt einen Lebensstil mit ständiger Erreichbarkeit, langen Arbeitszeiten und dem Übergehen der eigenen Bedürfnisse.picture alliance/dpa/dpa-tmn
© picture alliance/dpa/dpa-tmn
„Jedes Arbeiten ist ungesund, wenn es übersteigert ist“, sagt Mirriam Prieß. Die Ärztin und Autorin sieht in der sogenannten Hustle Culture vor allem fehlenden Respekt und Augenhöhe sich selbst gegenüber. „Wer sich in seiner Arbeit nicht mehr wohlfühlt oder sich selbst gar nicht mehr spürt, hat eine rote Linie überschritten“, sagt die Therapeutin.
Von den einen gefeiert, von den anderen kritisiert, beschreibt Hustle Culture (von engl. hustle - hasten, drängen) einen Lebensstil mit ständiger Erreichbarkeit, langen Arbeitszeiten und dem Übergehen der eigenen Bedürfnisse. Leistung und Output sind Messlatte für Erfolg und Anerkennung.
Grenzüberschreitung als Kick
Mirriam Prieß arbeitet unter anderem gemeinnützig mit Jugendlichen. Diese hätten ihr erklärt, wie es sei, diese „rote Linie“ zu überschreiten. „Es ist ein Kick und fühlt sich gut an, sich selbst zu überwinden“, gibt sie die Aussagen wieder. Schlecht fühle es sich nur für einen kurzen Moment an. „Danach ist es, als wäre man ein anderer Mensch, man gerät in einen Rausch, wo man der Meinung ist, alles sei möglich und man sei der Stärkste.“
Doch mit einer solchen Lebensweise ruinieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich selbst und ihr Team, ist die Ärztin überzeugt. Am Ende des Kicks steht häufig ein Burnout. Mirriam Prieß rät, sich folgende Fragen zu stellen: Befinde ich mich in meinem Job oder mit dem Team noch in gesunder Beziehung? Fühle ich mich gut? Komme ich selbst noch wesentlich vor?
Anerkennung ist an Leistung geknüpft
Wer diese Fragen mit Nein beantwortet, kann sich laut der Therapeutin fragen, ob Strukturen in einem selbst diese Hustle Culture ermöglichen. „Oft sind das Erfahrungen aus der Kindheit“, sagt die Therapeutin. „Wenn ich nicht um meiner selbst willen geliebt und anerkannt worden bin, knüpfe ich beides häufig an eine Leistung und Karriere.“
Sie habe leider die Erfahrung gemacht, dass viele Firmen genau solche Leute wollten, sagt Mirriam Prieß. „Denn diese Menschen sind bereit, über Grenzen zu gehen, auch über die eigene.“ So werde in einigen Jobs Hustle Culture gehypt und auch erwartet.
Die eigene Haltung ändern
„Da gilt es, einen Schritt zurückzutreten und nicht mitzumachen“, sagt die Ärztin. Nur hin und wieder kleine Pausen einzustreuen, reiche nicht aus, es gehe vielmehr um eine Haltungsänderung. Wo diese nicht akzeptiert werde, bleibe nur, den Job zu verlassen: „Anders geht es nicht. Für die eigene Gesundheit.“
Leistung an sich ist nicht schlecht, sagt Prieß, und auch Unterforderung sei ungesund. Doch man müsse in dem, was man tue, selbst vorkommen. „Dann ist Leistung immer an mein Wohlergehen gebunden und nicht an eine narzisstische Identifizierung“, sagt die Therapeutin. Wer so arbeite, habe Freude daran, das Bestmögliche zu tun und sich weiterzuentwickeln.





